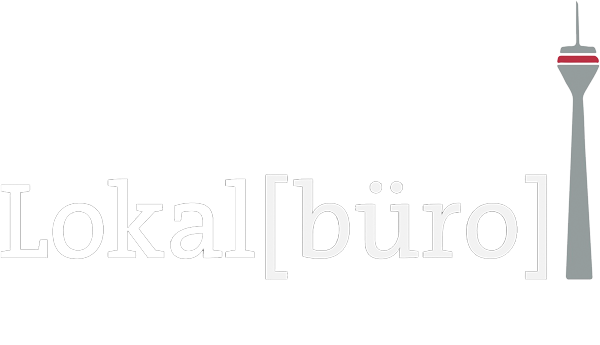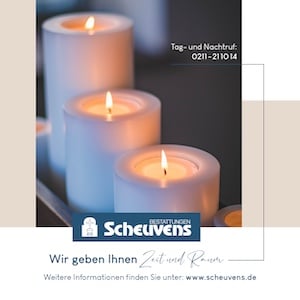Von Manfred Fammler
Ein Haus, eine Oper, wie sie nur Skandinavier denken können. Der Siegerentwurf des Wettbewerbs stammt vom Architekturbüro „Snoehetta“ aus Oslo. Er vereinigt Oper, Clara-Schumann-Musikschule und Musikbibliothek schlichtweg am besten, war sich die Jury einig.
Mit weit ausgebreiteten Armen steht Ratsherr Alexander Fils vor dem innerstädtischen Modell, in dessen Mitte das neue Gebäude prangt. Nach den Sichtachsen gefragt, da die neue Oper doch etwas eingezwängt zwischen Tonhallen‑, Oststraße und Wehrhahn steht, wandern seine Hände über die Schadowstraße.
„Über diese Sichtachse sieht man einen Teil und fragt sich: Was kommt da noch?“ Kurz gesagt, wandert seine Hand weiter zur Oststraße, von dort zum Wehrhahn und zum Schluss zur Jacobistraße. „Immer wieder“, so schwärmt der CDU-Politiker, „ändert sich die Ansicht des Gebäudes. Aus den verschiedenen Blickwinkeln sind nur Teilelemente erkennbar.“
Unzufriedenheit oder vielleicht sogar Enttäuschung sieht anders aus. Zudem werde das Opernhaus das erste in der Welt sein, das CO₂-neutral errichtet werde, verspricht der Vorsitzende des Planungsausschusses. Nachhaltigkeit und Ökologie, gepaart mit einer „markanten“ Bauweise, besäßen das Potenzial, dem Haus auch äußerlich internationales Renommee zu verschaffen.
Und überhaupt: Als letztendlich das Preisgericht den Siegerentwurf kürte, habe er nur „strahlende Gesichter gesehen“, sagt Heiner Farwick, Vorsitzender des Preisgerichts.
So viel war bei der Präsentation des Siegerentwurfs nicht zu erkennen. Nur so viel: Drei öffentliche Dachterrassen lassen den Blick Richtung Grafenberger Wald, Rhein oder Hofgarten in die Ferne schweifen, da das Gebäude bis zu 51 Meter hoch sein wird.
Es soll ein heller Stein (Sandstein) benutzt werden, und die Fassade ist durch zahlreiche Fenster durchbrochen – ein sehr großes übrigens als Panoramaausblick Richtung Karstadt. Dort, wo der Haupteingang zum Kaufhof lag, soll wohl auch die Oper betreten werden.
Das Erdgeschoss wird den „dritten Raum“, also den Gemeinschaftsraum, darstellen, wo sich Mieter und Besucher treffen können. Der Eingang zur Musikbibliothek wird in den oberen Stockwerken liegen.
Das „Feintuning“ wird in den kommenden Jahren Klarheit darüber bringen – ebenso wie über die Kosten, die eine Milliarde Euro nicht überschreiten sollen. Dabei verspricht OB Keller: „Die Finanzierung steht auf einem soliden Fundament.“
Doch bei aller Schönheit sollte ein Opernhaus – das ja kein reines Opernhaus mehr ist – effizient und funktional sein. Über diese Eigenschaften wachte Alexandra Stampler-Brown, Direktorin der Oper, mit Argusaugen.
„Dieses Gebäude ist besonders. Das ist ein Haus, das zeigt, was eigentlich ein Opernhaus der Zukunft sein soll – nämlich ein Magnet für Leute, die dort etwas anderes erfahren und etwas gemeinsam erleben möchten.“
Trotzdem habe sie als Nutzerin die letzten zwei Tage ganz genau darauf geachtet, dass alles praktikabel und funktional sei. Beispiel Anlieferzone – das sei ein „heißes Thema“ gewesen.
„Können unsere LKWs mit den Kulissen reinkommen? Und zwar nicht nur ein LKW, sondern auch mal zwei. Das war für die Planer eine große Herausforderung.“
Darüber hinaus stehe natürlich die Frage der Akustik. „Ist das eine gute Akustik im Saal, da unsere Sängerinnen und Sänger unverstärkt singen? Ergänzt sich dies mit dem Orchestergraben?“, fragt die Direktorin. Anscheinend wurden alle Fragen im Sinne des Ensembles geklärt.
Seit gestern beriet ein 25-köpfiges Gremium in der Rheinterrasse über die Zukunft und Entwicklung des Standortes „Alter Kaufhof“. Herausgekommen ist ein Entwurf, der architektonisch mannigfaltige Interpretationen zulässt und für die nächsten Jahrzehnte – wenn der Rat diesem Entwurf zustimmt – die Innenstadt bestimmen und verändern, wenn nicht sogar umkrempeln wird.
Farwick bezeichnet den Siegerentwurf als modern, markant und zugleich maßvoll. Die Architektur umfasst drei Baukörper, die sich sensibel an den städtebaulichen Kontext anpassen und das große Volumen des Projekts geschickt gliedern. Panoramafenster, Dachterrassen und ein zentral gelegenes öffentliches Forum verleihen dem Gebäude „eine hohe Aufenthaltsqualität“.
Besonders hervorgehoben wird der „dritte Ort“ – eine konsumfreie, frei zugängliche Eingangszone, die Begegnung, Offenheit und städtisches Leben im Erdgeschoss fördern soll. Der Entwurf überzeuge zudem, so Farwick, durch seine Funktionalität: Bühnentechnik, Säle, Probenräume und weitere Bereiche seien durchdacht angeordnet und erfüllten die vielfältigen Anforderungen des Opernbetriebs.
Mit sichtbarer Zufriedenheit verkündet Bauherr und Oberbürgermeister Stephan Keller den Sieger. Er spricht von einem Entwurf, der „architektonische Qualität mit Zukunftsvision“ verbinde – exakt jener Anspruch, den er selbst für das gesamte Projekt formuliert habe.
Dabei verliert er die anderen Finalisten nicht aus dem Blick. Seine Wertschätzung für das „insgesamt sehr hohe Niveau“ der Beiträge wirkt wie ein bewusster Hinweis darauf, dass Düsseldorf sich als internationale Kulturstadt auf Augenhöhe begreift.
Das neue Opernhaus soll ein Ort werden, der Stadtlandschaft, Innenstadtleben, kulturelle Identität und gesellschaftliche Offenheit neu zusammendenkt. Keller formuliert es als Prinzip: Die Oper soll „ein offenes und einladendes Haus der Kultur“ sein – ein Ort, der Kunst und Alltag, Hochkultur und Bildung, Profis und Nachwuchs zusammenführt.
Dass erstmals Oper, Ballett, die Clara-Schumann-Musikschule und die Musikbibliothek unter einem Dach zusammenkommen, bezeichnet er als „einzigartig“ und „zukunftsweisend“.
Noch kurz zum Wettbewerbssieger: Die Skandinavier kreierten die Oper in Oslo, die Bibliothek in Alexandria und die norwegische Botschaft in Berlin. Nebenbei entwarfen sie die Rückseite der norwegischen Geldscheine.
Allerdings ist der Gewinner des Wettbewerbs, der die Oper in Oslo, die Bibliothek in Alexandria und die norwegische Botschaft in Berlin entwarf – und so ganz nebenbei die Rückseite der norwegischen Geldscheine –, vielleicht doch nicht der endgültige Sieger.
Denn innerhalb der nächsten Wochen werden „vergaberechtliche Verhandlungen mit allen vier Siegern geführt, mit dem Ziel, das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln“, so die Stadt in einer Mitteilung. Schließlich sollen die Baukosten die Milliardengrenze nicht überschreiten.
Nächstes Jahr soll über den Generalplaner entschieden werden. Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss sind für 2028 geplant.
In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob die neue Rheinoper das gleiche Schicksal erfährt wie der Rheinufertunnel. Erst verpönt und verspottet oder als Millionengrab verschrien, ist dieses Bauwerk aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Die Stadt öffnete sich zum Fluss.
Vielleicht öffnet sich die neue Oper der Stadtgesellschaft – was der alten Oper an der Heinrich-Heine-Allee verwehrt war. Aber diese Partitur wird erst noch geschrieben. Kakophonie nicht ausgeschlossen.
Am 18. November wird der Entwurf der Öffentlichkeit präsentiert. Bis zum heutigen Tag hätten sich bereits 1.000 Menschen angemeldet, sagte OB Keller. Die Oper bewegt – auch zukünftig.
Die Platzierungen:
-
Platz: Snoehetta, Oslo
-
Platz: HPP Architekten GmbH, Köln/Düsseldorf
-
Platz: kister scheithauer gross architekten GmbH, Köln; Studio Gang Architects, Chicago
-
Platz: wulf architekten, Stuttgart

Nach der Sitzung des Preisgerichts im Wettbewerb für das “Opernhaus der Zukunft” (v.l.): Alexandra Stampler-Brown, Geschäftsführende Direktorin der Oper am Rhein, Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, sowie Architekt und Stadtplaner Heiner Farwick, Vorsitzender des Preisgerichts, mit dem Modell des Siegerentwurfs. © Lokalbüro